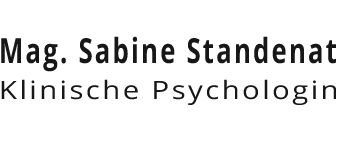MEHR WÄRME UND MENSCHLICHKEIT IM KRANKENHAUS
Viele Patienten fühlen sich im Spital seelisch alleingelassen oder unfreundlich behandelt.
Mehr Verständnis und Zuwendung vom medizinischen Personal würde die Situation erleichtern. Jetzt gab es an der I. Med. Abteilung (Vorstand Univ. Prof. Dr. H. Ludwig) im Wiener Wilhelminenspital erstmals ein Fortbildungsseminar für Ärzte zu diesem Thema.
„Ich war so schrecklich verzweifelt und habe nur geweint. Niemand hat mit mir geredet, mich berührt oder gar in den Arm genommen. Vielleicht haben sie das bei ihrer Ausbildung nicht gelernt, oder es ist ihnen abgewöhnt worden. Aber – das was ich gebraucht hätte, erfordert keine spezielle Ausbildung. Man muss dafür nur einfach menschlich sein.“
Diese Worte einer Patientin haben mich tief berührt. Seit vielen Jahren arbeite ich als Psychologin in Krankenhäusern und habe oft erlebt, wie wenig manchmal nötig ist, um einem Menschen in einer schweren Stunde Trost zu spenden. Ein Lächeln, ein liebes Wort, eine sanfte Berührung. Ich weiß, dass viele Ärzte ihr Bestes geben, aber den „Gott in Weiß“ – autoritär, kurz angebunden, distanziert und damit oft verletzend, gibt es noch immer.
Viele Patienten sind mit dem Verhältnis zu ihrem Arzt unzufrieden. Allerdings betrifft das selten die fachliche Kompetenz, sondern ein abweisendes, kaltes Kommunikationsverhalten. Die Frage lautet also: Wie kann die Beziehung zwischen Arzt und Patient zu einer Partnerschaft werden, in der man sich gegenseitig respektiert und vertraut?
Für mich war es immer ein großes Anliegen, die zwischenmenschliche Situation für den Kranken im Spital zu verbessern. Dafür arbeite und kämpfe ich. So habe ich mit großem Engagement das Angebot von Prof. Ludwig angenommen, ein Seminar für Ärzte unter dem Titel „Mehr Wärme und Menschlichkeit“ im Krankenhaus“ zu leiten.
Niemand vom medizinischen Personal wird in der Ausbildung im emotionalen Umgang mit Krankheit, Leid, Grauen und Tod geschult. Es ist auch unmöglich für Ärzte und Schwestern, das Schicksal jedes einzelnen gefühlsmäßig mitzutragen. So gehen viele innerlich auf Distanz, um sich selbst zu schützen. Für den Patienten aber ist seine Erkrankung eine zutiefst aufwühlende Erfahrung.
Er hat körperliche Probleme, Therapienebenwirkungen und ist oft völlig aus dem inneren Gleichgewicht. Im Falle einer schweren Erkrankung ist er auch mit der Möglichkeit seines eigenen Todes konfrontiert. Diese Ausgangssituation – der distanzierte Arzt mit seiner Routinetätigkeit auf der einen Seite und der Patient mit der emotionalen Ausnahmesituation auf der andern Seite – führt oft zu Problemen, die bei mehr Verständnis leicht aus der Welt zu schaffen wären. Für den Arzt sollte es darum gehen: „Wie schütze ich mich selbst und in welchem Ausmaß ist es mir trotzdem möglich, dem Patienten Anteilnahme und Wärme zu zeigen? Sind meine Möglichkeiten wirklich schon ausgeschöpft oder könnte ich mehr tun oder manches ein wenig anders?“
Im Laufe der Jahre habe ich unzählige Berichte von Patienten über kränkende, aber auch erfreuliche Vorkommnisse gesammelt. Beide Listen habe ich den Ärzten im Seminar präsentiert.
Was sollte der Arzt im Umgang mit dem Patienten vermeiden?
- dominantes Verhalten, das signalisiert: „Ich habe hier das Sagen und du tust, was ich will“
- unverständliche Fachausdrücke
- Unfreundlichkeiten, ungeduldige Gesten, genervte Mimik und Redewendungen wie:
- „Das habe ich Ihnen doch gerade erklärt“
- „Das müssen Sie schon mir überlassen“
- „Jetzt reißen Sie sich aber zusammen“
Was wünschen sich kranke Menschen im Spital von ihrem Arzt?
- Aufmerksamkeit! Das heißt: Augenkontakt, verbindliches Lächeln, freundliche Stimme
- einfühlsame Diagnose – und Therapiemitteilungen in einer verständlichen Sprache
- Anteilnahme
- Zeit!!
- Hilfe bei Entscheidungen, ohne dominiert zu werden
- Komplementärmedizin nicht grundsätzlich verdammen, sondern dem Patienten die Gelegenheit geben, auch über seine diesbezüglichen Wünsche zu sprechen (viele halten die Besuche beim Alternativmediziner geheim)
- tröstender Körperkontakt in Extremsituationen
Bei ungünstigen Diagnosen ist es ganz wichtig, sich Zeit zu nehmen und den Patienten über seine Gefühle sprechen zu lassen. Ein Satz wie „Sie haben Krebs“ im Hinausgehen ist eine ungeheuerliche Grausamkeit. Auch wenn jemand stirbt, sollte er nicht alleine gelassen werden. Ich habe oft erlebt, dass Sterbende noch über etwas sprechen wollen, aber ganz genau fühlen, dass niemand Zeit hat oder in der Lage ist, zuzuhören. Nicht jeder kann einen anderen beim Sterben begleiten. Aber es wäre wichtig, zumindest zu veranlassen, dass ein Psychologe oder Seelsorger sich des Patienten annimmt. Diese Helfer sind darin geschult, einfühlsam herauszufinden, ob Beistand erwünscht ist.
Ich weiß, dass viele Ärzte und Therapeuten gute Arbeit leisten. Aber unser Beruf unterscheidet sich grundlegend von anderen. Wir sind Begleiter von Menschen in Ausnahmesituationen und wie keine andere Berufsgruppe täglich mit Leid und Tod konfrontiert. Neben unserer fachlichen Kompetenz sind also auch zutiefst menschliche Qualitäten gefragt – Einfühlungsvermögen, Wärme und Herzlichkeit. Wenn wir unsicher sind, was zu tun ist, wird eine einzige Frage helfen, den richtigen Weg zu finden: Welche Behandlung würde ich mir wünschen, wenn die Krankheit mich betrifft oder einen Menschen den ich liebe?
Statement 1:
Univ. Prof. Dr. H. Ludwig,
„Die oberste Priorität für alle im medizinischen Bereich Tätigen sollte in der Erfassung der Bedürfnisse und Sorgen der Patienten liegen. Nur dadurch kann bestmögliche Behandlung geleistet werden. Daher ist eine optimale Kommunikation von größter Bedeutung. Allerdings wird das nicht immer so gesehen und nicht selten kommt es zu Missverständnissen und unnötigen Kränkungen. Überall wo Menschen aktiv sind, können leider auch Fehler unterlaufen. Mein Bestreben ist, solche möglichst von vornherein auszuschließen. Von solchen Seminaren profitieren also Ärzte und Patienten, weil sie zum besseren gegenseitigen Verständnis beitragen.“
Statement 2:
Oberarzt Dr. Clemens Leitgeb,
internistischer Onkologe
„Es ist wichtig, den Patienten ganzheitlich zu sehen, mit allen seinen Ängsten und Bedürfnissen. Natürlich ist das leichter in einer Ordination zu verwirklichen, als in einem Spitalsbetrieb, wo wenig Zeit zur Verfügung steht. Aber das Begleiten auch in gefühlsmäßigen Dingen muss immer einen wichtigen Stellenwert haben. So finde ich diese Seminare gut, um uns Ärzten das in Erinnerung zu rufen“
Statement 3:
Dr. Heidemarie Seemann,
Assistenzärztin
„Meine Ausbildung in Psychoonkologie hat meine Sensibilität für die Bedürfnisse der Patienten noch gesteigert. Ich kann ihnen und auch den Angehörigen nur helfen, wenn ich sie nicht nur körperlich, sondern auch als psychische und spirituelle Wesen wahrnehme. Solche Seminare können da nur hilfreich sein.“